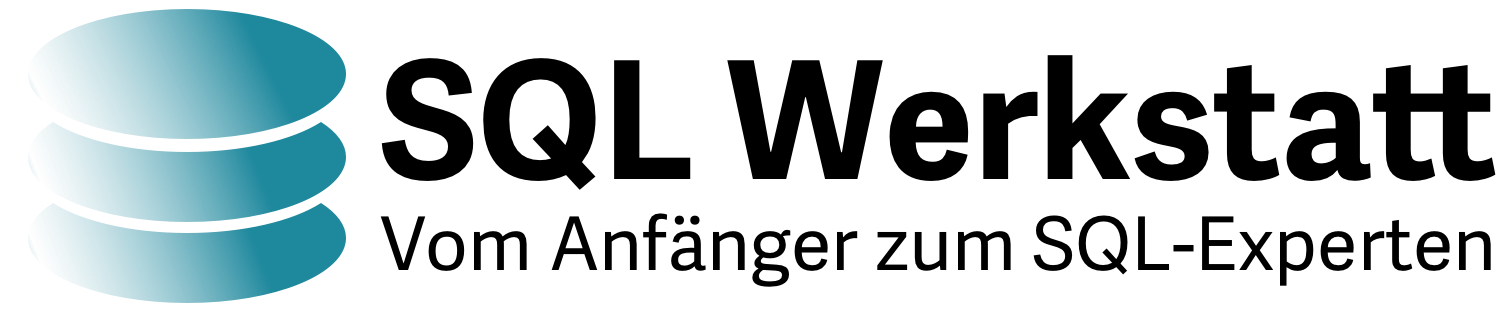Bevor wir entscheiden, ob SQL eine Programmiersprache ist, lohnt es sich kurz klarzustellen, was man unter einer Programmiersprache versteht. Grob gesagt ist eine Programmiersprache ein formales System, mit dem Menschen einer Maschine — z. B. einem Computer — Anweisungen geben können.
Allgemeine Merkmale
- Syntax: Eine festgelegte Schreibweise und Struktur. Ohne korrekte Syntax kann eine Anweisung nicht verstanden oder ausgeführt werden.
- Semantik / Befehle: Es gibt definierte Operationen oder Befehle, die bewirken, dass etwas passiert (z. B. Berechnungen, Ein-/Ausgabe, Datenmanipulation).
- Ausführbarkeit: Programme oder Skripte können von einer Laufzeitumgebung oder einem Compiler/Interpreter ausgeführt werden.
- Abstraktionsmittel: Variablen, Funktionen, Datentypen und Kontrollstrukturen, mit denen du komplexe Aufgaben strukturieren kannst.
Turing-Vollständigkeit als Kriterium
Ein häufig genutztes Kriterium, um die Ausdrucksstärke einer Sprache zu bewerten, ist die sogenannte Turing-Vollständigkeit. Eine Sprache gilt als Turing-vollständig, wenn sie jede berechenbare Funktion ausdrücken kann — kurz: sie kann beliebige Berechnungen ausführen, sofern genügend Zeit und Speicher vorhanden sind. Turing-Vollständigkeit ist ein theoretisches Maß für die Mächtigkeit einer Sprache, sagt aber nicht notwendigerweise etwas über ihre praktische Eignung für bestimmte Aufgaben aus.
Beispiele
Zu den klassischen, allgemein anerkannten Programmiersprachen gehören zum Beispiel:
- Python — interpretierte, vielseitige Sprache, oft für Skripte, Datenanalyse und Web.
- Java — kompilierte, objektorientierte Sprache, weit verbreitet in Unternehmensanwendungen.
- C# — ähnliche Einsatzgebiete wie Java, stark in Microsoft-Ökosystemen.
Diese Sprachen bieten typische Programmiersprachen-Funktionen wie Schleifen, Bedingungen, Funktionen und umfangreiche Laufzeitbibliotheken.
Wichtig zu merken
- Die Definition einer „Programmiersprache“ ist nicht komplett strikt — es gibt Graustufen.
- Turing-Vollständigkeit ist ein strenges, theoretisches Kriterium, das eine Sprache mächtig, aber nicht automatisch „praktischer“ macht.

Arten von Programmiersprachen
Programmiersprachen lassen sich auf unterschiedliche Weise kategorisieren. Eine gängige Einteilung basiert darauf, wie eine Sprache Anweisungen formuliert und ausführt.
Imperative Sprachen
In imperativen Sprachen beschreibst du Schritt für Schritt, wie ein Ziel erreicht werden soll. Der Fokus liegt auf dem Ablauf der Befehle.
- Beispiele: C, Python, Java
- Merkmale:
- Nutzung von Variablen, Schleifen und Bedingungen
- Explizite Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte
Deklarative Sprachen
In deklarativen Sprachen beschreibst du was erreicht werden soll, ohne die einzelnen Schritte genau vorzugeben.
- Beispiele: SQL, HTML
- Merkmale:
- Fokus auf dem Ergebnis, nicht auf dem Ablauf
- Die „Engine“ oder der Interpreter entscheidet, wie das Ziel umgesetzt wird
Skriptsprachen vs. kompilierte Sprachen
Neben der Einteilung in imperativ und deklarativ gibt es noch die Unterscheidung zwischen Skriptsprachen und kompilierten Sprachen.
- Skriptsprachen: werden meist direkt interpretiert, ohne vorherigen Compiler-Durchlauf (z. B. JavaScript, Python).
- Kompilierte Sprachen: werden vor der Ausführung in Maschinencode übersetzt, was oft zu schnellerer Ausführung führt (z. B. C, Go, Rust).
Wichtig zu merken
- Imperativ = Wie angeben, deklarativ = Was angeben.
- SQL ist primär deklarativ, kann aber durch Erweiterungen (z. B. PL/SQL) imperative Elemente enthalten.
- Skript vs. kompiliert bezieht sich auf die Ausführungsart, nicht auf den Stil der Sprache.
Was ist SQL?
SQL steht für Structured Query Language und ist eine standardisierte Sprache zur Arbeit mit relationalen Datenbanken. Sie wurde in den 1970er-Jahren bei IBM entwickelt, um Daten in Tabellenform effizient abzufragen und zu bearbeiten.
Ursprung und Zweck
Der Hauptzweck von SQL ist es, auf Datenbanken zuzugreifen und diese zu verwalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen gibt SQL in der Regel nicht Schritt für Schritt an, wie eine Aufgabe erledigt wird. Stattdessen beschreibt es das gewünschte Ergebnis – die Datenbank-Engine entscheidet, wie dieses Ergebnis am besten erzielt wird.
Hauptaufgaben von SQL
- Daten abfragen:
Mit Befehlen wie
SELECTkönnen gezielt Daten aus Tabellen gelesen werden. - Daten manipulieren:
Befehle wie
INSERT,UPDATEundDELETEändern Inhalte in der Datenbank. - Datenstrukturen verwalten:
Befehle wie
CREATE TABLEoderALTER TABLElegen fest, wie Daten gespeichert werden. - Berechtigungen steuern:
Mit Anweisungen wie
GRANTundREVOKEkönnen Zugriffsrechte vergeben oder entzogen werden.
SQL-Standard und Dialekte
SQL ist international standardisiert (ISO/IEC), doch die meisten Datenbanksysteme verwenden eigene Erweiterungen oder Dialekte, um zusätzliche Funktionen anzubieten. Beispiele dafür sind:
- MySQL: weit verbreitet in Webanwendungen
- PostgreSQL: mächtiger Open-Source-SQL-Server mit vielen Features
- Microsoft SQL Server: häufig in Unternehmensumgebungen
- Oracle Database: kommerzielles System mit umfangreichen Erweiterungen
Wichtig zu merken
- SQL ist speziell für den Umgang mit relationalen Datenbanken entworfen.
- Die Sprache ist deklarativ: Du beschreibst was du möchtest, nicht wie es umgesetzt wird.
- Es gibt viele Dialekte, aber der Kern von SQL ist überall ähnlich.
Merkmale von SQL
SQL unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von klassischen Programmiersprachen. Die Sprache ist vor allem darauf ausgelegt, Daten zu beschreiben und zu manipulieren, nicht um allgemeine Softwarelogik zu implementieren.
Deklarative Natur
SQL ist in erster Linie deklarativ. Das bedeutet: Du gibst an, was du aus einer Datenbank haben möchtest, und die Datenbank entscheidet selbst, wie sie diese Anweisung am effizientesten umsetzt.
Beispiel:
SELECT name FROM kunden WHERE land = 'Deutschland';
Hier beschreibst du das gewünschte Ergebnis (Namen aller Kunden aus Deutschland),
ohne anzugeben, welche Tabellen-Scans oder Indexe genutzt werden sollen.
Begrenzte Kontrollstrukturen
Reines SQL bietet nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten für Kontrolllogik:
- Keine klassischen Schleifen wie
foroderwhile - Einfache Bedingungen über
CASE-Ausdrücke - Logische Operatoren wie
AND,ORundNOT
Erweiterungen als Hybridlösungen
Viele Datenbanksysteme bieten Erweiterungen, die imperativen Code ermöglichen. Dazu gehören:
- PL/SQL (Oracle) – fügt Schleifen, Variablen und Prozeduren hinzu
- T-SQL (Microsoft SQL Server) – erlaubt u. a. Bedingungen und Schleifen
- PL/pgSQL (PostgreSQL) – ähnlich zu PL/SQL, aber für PostgreSQL
Diese erweiterten Varianten machen SQL zu einer Mischform aus deklarativer und imperativer Sprache.
Wichtig zu merken
- Reines SQL ist deklarativ und auf Datenoperationen fokussiert.
- Komplexe Programmlogik ist erst mit Dialekt-Erweiterungen möglich.
- Die Trennung von Was und Wie ist ein zentrales Prinzip von SQL.
Ist SQL turingvollständig
In der Informatik bezeichnet Turing-Vollständigkeit die Fähigkeit einer Sprache, jede theoretisch berechenbare Aufgabe ausdrücken zu können – vorausgesetzt, es stehen unbegrenzt Zeit und Speicher zur Verfügung.
Reines SQL
Standard-SQL in seiner reinen Form ist nicht turingvollständig. Es fehlt an grundlegenden Kontrollstrukturen wie Schleifen und rekursiven Funktionen, die nötig sind, um beliebige Berechnungen zu formulieren.
Beispiel: Eine Aufgabe, die wiederholt Berechnungen durchführen muss, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, kann in reinem SQL nicht direkt abgebildet werden.
SQL mit Erweiterungen
Viele Datenbanksysteme bieten Erweiterungen, die SQL imperative Elemente hinzufügen. Mit diesen Erweiterungen kann SQL turingvollständig werden. Beispiele:
- PL/SQL (Oracle) – unterstützt Schleifen, Bedingungen, Variablen und Prozeduren
- T-SQL (Microsoft SQL Server) – ermöglicht komplexe Kontrollstrukturen und Cursor-Verarbeitung
- PL/pgSQL (PostgreSQL) – fügt Schleifen, Funktionen und Bedingungen hinzu
Sobald solche Funktionen vorhanden sind, kann SQL im Prinzip jede Berechnung ausdrücken – ähnlich wie klassische Programmiersprachen.
Wichtig zu merken
- Reines SQL ist nicht turingvollständig.
- Mit Dialekterweiterungen kann SQL turingvollständig werden.
- Die Turing-Vollständigkeit ist ein theoretisches Kriterium und sagt wenig über die praktische Nützlichkeit für Datenbankaufgaben aus.
SQL vs. imperativen Sprachen (Python, Java)
SQL unterscheidet sich grundlegend von imperativen Programmiersprachen wie Python oder Java. Der wichtigste Unterschied liegt darin, wie Anweisungen formuliert werden und welchen Zweck die Sprache erfüllt.
Unterschiede in Syntax und Logik
-
SQL: Deklarativ – du beschreibst was du möchtest.
Beispiel:
SELECT name FROM kunden WHERE land = 'Deutschland';Die Datenbank entscheidet selbst, wie sie diese Abfrage intern optimiert und ausführt. -
Python/Java: Imperativ – du beschreibst wie das Ziel erreicht wird.
Beispiel (Python):
Hier wird jeder Schritt explizit vorgegeben.for kunde in kunden: if kunde.land == "Deutschland": print(kunde.name)
Einsatzgebiete
- SQL: Zugriff auf und Verwaltung von Daten in relationalen Datenbanken – Abfragen, Einfügen, Ändern und Löschen von Daten.
- Python/Java: Allgemeine Softwareentwicklung, Automatisierungen, Webanwendungen, Spiele, Desktop-Apps und vieles mehr.
Wichtige Unterschiede im Überblick
| Kriterium | SQL | Python / Java |
|---|---|---|
| Art der Sprache | Deklarativ | Imperativ |
| Kontrollstrukturen | Begrenzt (z. B. CASE) |
Umfangreich (z. B. if, for, while) |
| Einsatzgebiet | Datenbanken | Allgemeine Programmierung |
| Turing-Vollständigkeit | Nein (ohne Erweiterungen) | Ja |
Wichtig zu merken
- SQL ist für Datenbankoperationen optimiert, nicht für allgemeine Programmierung.
- Imperative Sprachen bieten mehr Kontrolle über den Ablauf, erfordern aber auch mehr Details bei der Umsetzung.
- In der Praxis werden SQL und imperative Sprachen oft kombiniert – SQL für die Daten, Python/Java für die Logik.
SQL vs. andere deklarative Sprachen (HTML, CSS)
SQL gehört – wie HTML oder CSS – zu den deklarativen Sprachen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie beschreiben, was erreicht werden soll, nicht wie es im Detail umgesetzt wird. Trotzdem gibt es zwischen SQL und anderen deklarativen Sprachen wesentliche Unterschiede.
Ähnlichkeiten
-
Fokus auf dem Ergebnis:
- In SQL:
SELECT name FROM kunden WHERE land = 'Deutschland';– gibt an, welche Daten gewünscht sind. - In HTML:
<h1>Überschrift</h1>– gibt an, dass eine Überschrift angezeigt werden soll.
- In SQL:
-
Keine klassischen Kontrollstrukturen wie
foroderwhile. - Die „Engine“ (z. B. der Datenbankserver oder der Browser) übernimmt die Umsetzung.
Unterschiede
- SQL: Datenbankorientiert – dient dem Abfragen, Manipulieren und Verwalten von Daten in Tabellen.
- HTML: Strukturbeschreibung – legt fest, wie Inhalte in einem Browser dargestellt werden.
- CSS: Designbeschreibung – steuert das Aussehen (Farben, Layout, Schriftarten) von HTML-Elementen.
- SQL kann mit Erweiterungen teilweise imperative Elemente enthalten – HTML und CSS hingegen nicht.
Einsatzkontext
Während SQL typischerweise auf dem Server im Rahmen von Datenbankoperationen ausgeführt wird, arbeiten HTML und CSS im Browser, um Inhalte für den Nutzer darzustellen. Beide Welten können aber miteinander verbunden sein: Webanwendungen holen Daten per SQL aus einer Datenbank und präsentieren sie anschließend mithilfe von HTML und CSS.
Wichtig zu merken
- SQL, HTML und CSS sind deklarativ, unterscheiden sich aber stark im Einsatzzweck.
- SQL ist auf Datenlogik spezialisiert, HTML und CSS auf Präsentation und Layout.
- In modernen Anwendungen arbeiten sie oft Hand in Hand: SQL für die Daten, HTML/CSS für die Darstellung.
Die Praxis: Warum die Frage wichtig ist
Ob SQL nun als Programmiersprache gilt oder nicht, mag auf den ersten Blick wie eine theoretische Diskussion wirken. In der Praxis hat die Antwort jedoch direkte Auswirkungen auf die Arbeit von Entwicklern, Datenbank-Experten und sogar auf die Formulierung von Stellenanzeigen.
Für Entwickler
- SQL ist ein zentrales Werkzeug, wenn du mit relationalen Datenbanken arbeitest. Auch wenn du primär in einer anderen Sprache wie Python, Java oder JavaScript entwickelst, wirst du oft SQL nutzen, um Daten zu lesen oder zu verändern.
- Die Entscheidung, wann SQL direkt verwendet wird und wann man auf objektorientierte Ansätze oder ORMs (Object-Relational Mappers) setzt, kann Einfluss auf die Performance und Wartbarkeit einer Anwendung haben.
Für Datenbank-Experten
- Ein tiefes Verständnis von SQL – einschließlich Dialekten und Optimierungstechniken – ist essenziell für effiziente Datenbankabfragen.
- Die Betrachtung von SQL als „eigene Programmiersprache“ kann helfen, den Stellenwert dieser Fähigkeiten intern oder extern zu vermitteln.
Für Arbeitgeber
- Wenn in Stellenausschreibungen „Programmiersprachen“ aufgelistet werden, sollte klar sein, ob SQL dazugezählt wird.
- Eine präzise Beschreibung der benötigten SQL-Kenntnisse (z. B. „Grundlagen“, „Performance-Tuning“, „Erfahrung mit PL/SQL“) hilft, passende Bewerber anzusprechen.
Fazit für die Praxis
Unabhängig von der theoretischen Einordnung ist SQL ein unverzichtbares Werkzeug in vielen IT-Bereichen. Wer mit Daten arbeitet, kommt um SQL-Kenntnisse kaum herum – egal, ob man es nun als Programmiersprache oder als Abfragesprache bezeichnet.
Fazit: SQL – eine (besondere) Programmiersprache?
Die Frage, ob SQL eine Programmiersprache ist, lässt sich nicht mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Rein technisch betrachtet erfüllt SQL viele Merkmale einer Programmiersprache: Es hat eine definierte Syntax, feste Befehle und wird von einem Interpreter (der Datenbank-Engine) ausgeführt.
Allerdings ist SQL in seiner reinen Form nicht turingvollständig und daher nicht so flexibel wie allgemeine Programmiersprachen. Es ist deklarativ und stark auf den Anwendungsbereich „relationale Datenbanken“ fokussiert. Mit Erweiterungen wie PL/SQL oder T-SQL kann es jedoch imperativ erweitert und sogar turingvollständig werden.
Zusammenfassung der Argumente
- Pro Programmiersprache: Eigene Syntax, Ausführbarkeit, Variablen, logische Ausdrücke.
- Kontra Programmiersprache: Eingeschränkte Kontrollstrukturen, nicht universell einsetzbar.
- Sonderfall: Eine spezialisierte Sprache, optimiert für den Umgang mit Daten.
Eigene Einschätzung
SQL ist am besten als Spezialsprache für Datenbanken zu verstehen. Es ist mächtig in seinem Bereich, aber nicht darauf ausgelegt, beliebige Softwarelogik zu implementieren. In diesem Sinne kann man SQL als Programmiersprache für Daten bezeichnen.
Weiterführende Gedanken
Die Datenlandschaft entwickelt sich weiter: NoSQL-Datenbanken, Graphdatenbanken und Abstraktionsebenen wie ORMs verändern, wie wir mit Daten arbeiten. Trotzdem bleibt SQL in vielen Projekten der Standard – und ein Verständnis seiner Stärken und Grenzen ist für Entwickler, Datenanalysten und Datenbank-Administratoren gleichermaßen wertvoll.
Ist SQL eine Programmiersprache? Ein Blick auf die Definition
Bevor wir entscheiden, ob SQL eine Programmiersprache ist, lohnt es...
Artikel lesenDatentypen unter der Lupe: Wie INT, VARCHAR & Co. deine Datenbank effizient machen
Stell dir vor, deine Datenbank ist wie ein großer Schrank...
Artikel lesenDatenbereinigung mit SQL: Duplikate entfernen, NULLs behandeln, Strings reparieren
Datenbereinigung ist ein entscheidender Schritt in jedem Datenprojekt. Unsaubere Daten...
Artikel lesenCAST, CONVERT & Co.: So meisterst du Datentypkonvertierungen in SQL
Daten liegen in SQL-Datenbanken in unterschiedlichen Formaten vor – etwa...
Artikel lesen